Schaut man sich die Produkte an, die sich aus der Dotcom-Blase retten konnten, fällt etwas Interessantes auf. Fast alle diese Unternehmen haben ein natürliches Wachstum hinter sich. Unternehmen wie Skype, Amazon, Paypal und eBay haben sich erst langsam auf dem Markt etabliert.
Durch ein gesundes Wachstum wächst auch die Erfahrung in der eigenen Branche solider. Zudem ist die Produktentwicklung an die Wünsche der Zielgruppe gekoppelt: Viele Probleme und Chancen zeigen sich erst durch die langfristige Nutzung. Das sind Anzeichen einer evolutionären Veränderung. Irgendwann rechtfertigt sich der Nutzen des Produkts. Daraus folgt schließlich eine Revolution. Nicht umgekehrt.
Das Prinzip ist in Social Media nicht anders. Auch hier haben sich Medien langsam etabliert und später erst revolutionäre Züge angenommen. Diese Erfahrung hat auch Facebook hinter sich.
Mark Zuckerbergs „The Facebook“ erwachte einst als Studenten-Jahrbuch 2004 zum Leben. Das ist fast 8 Jahre her. In der IT-Welt gilt das als ein halbes Jahrhundert.
Die Globalisierung von Facebook ließ lange auf sich warten. In deutscher Sprache gibt es das Portal seit ungefähr vier Jahren. Aber auch andere erfolgreiche Social Networks wie Xing, YouTube und Delicious konnten sich erst nach und nach behaupten und wurden nicht sofort von der Community akzeptiert. Eine Revolution braucht nun mal ihre Zeit, bis sie in den Köpfen der Leute angekommen ist.
Das Prinzip des „Long Tail“ von Gladwell besagt, dass Unternehmen in Internetmärkten die meisten ihrer Umsätze zunächst durch Nischenprodukte erwirtschaften. Es dauert eine Weile, bis sich das Unternehmen daraus befreit und den Markt revolutioniert. Dieses Prinzip trifft oft auf erfolgreiche Unternehmen zu. Schaut man sich die Wachstumskurven von LinkedIn und Facebook genauer an, fällt auf, dass beide eine gleichmäßig steigende Kurve haben.
Die zwei Informationswissenschaftler Linde und Stock weisen auf sogenannte Netzwerkeffekte hin. Hiernach wird ein Produkt erst durch die Nutzung von immer mehr Konsumenten irgendwann erfolgreich. Gledwell bezeichnet diesen Punkt als den „Tipping Point“. Eine gewisse Zeit wird benötigt, bis sich die Konsumenten auf natürliche Weise an ein Produkt gewöhnt haben. Erst später wird eine allgemeine Akzeptanz des Produkts erkennbar.
Google Plus bewegt sich derzeit an diesen Grundsätzen vorbei. Eine evolutionäre Entwicklung hat der Neuling nicht durchlaufen. Er erscheint wie ein junger Schulanfänger, der aufgrund seiner Überlegenheit die Unterstufe überspringt und direkt sein Abitur machen soll. Dabei ist das Portal gerade mal ein paar Monate jung. Das explosionsartige Wachstum ist alles andere als natürlich, sondern eher anabol – und das Steroid ist Google. Es ist kein Long, sondern eher ein „Short Tail“. Die Vergangenheit zeigt, dass die meisten solcher Unternehmen genauso schnell vom Markt verschwanden, wie sie gekommen waren.
Eine plötzliche Marktpenetration ist oft ein Hinweis auf eine Euphorie. Ähnlich erging es auch Second Life, das in letzten Atemzügen liegt. Der Hype um virtuelle Welten hatte zunächst eine große Begeisterung ausgelöst. Nachdem die Nutzer Second Life getestet hatten, zeigte sich schließlich kein Mehrwert für die Teilnehmer. Damals hatten Unternehmen wie Adidas, Mercedes und Sony immense Summen für Marketing-Projekte in das neue 3D-Medium investiert. IBM sorgte für Schlagzeilen, als sie 10 Millionen Dollar Budget für das angeblich neue „Web 3“ (3 sollte angeblich für 3D stehen) zur Verfügung stellten. Das traurige Bild waren leere virtuelle Räume – weit und breit weder User noch Akteure, von Zielgruppen kaum zu sprechen. Die meisten Nutzer kehrten laut einer Studie nicht wieder zurück.
Für Google sind solche Pleiten nichts Neues. Die mit Hochstimmung gepriesene Kommunikationsplattform Google Wave überlebte ebenfalls keine zwei Jahre. Im August 2010 stellte Google die Entwicklung ein. Diese „Pleitewelle“ hat Google nicht sonderbar beeinflusst. Google Wave war ein Experiment unter vielen. Das Produktportfolio von Google ist zu groß, als dass es auf das eine oder andere Produkt ankäme.
Geld fließt nicht
 Derweil reden die meisten Beobachter von Mitgliederzahlen. Je größer und schneller, desto besser. Die größten Mitgliederzahlen sind allerdings wenig wert, wenn der finanzielle Nutzen für den Anbieter nicht sichtbar ist. Kostenlose Angebote im Web sind seit der Dotcom-Krise das ewige Dilemma der Informationsgesellschaft. Früher oder später muss ein Zahlungskonzept her, damit ein Portal überleben kann. Die Hoffnungsträger sind dabei schon immer die Konzerne gewesen – Werbung soll alles finanzieren.
Derweil reden die meisten Beobachter von Mitgliederzahlen. Je größer und schneller, desto besser. Die größten Mitgliederzahlen sind allerdings wenig wert, wenn der finanzielle Nutzen für den Anbieter nicht sichtbar ist. Kostenlose Angebote im Web sind seit der Dotcom-Krise das ewige Dilemma der Informationsgesellschaft. Früher oder später muss ein Zahlungskonzept her, damit ein Portal überleben kann. Die Hoffnungsträger sind dabei schon immer die Konzerne gewesen – Werbung soll alles finanzieren.
Es ist richtig, dass Unternehmen immer dort investieren, wo sich die Zielgruppe aufhält. Allerdings sind Unternehmen an langfristigen Investments interessiert. Keiner möchte in ein Social Network investieren, dessen Zukunft nicht sicher ist. Die Angst vor Fehlinvestments ist größer als je zuvor. Die Dotcom-Blase haben Unternehmen noch schmerzhaft in Erinnerung. Die Unternehmen möchten nicht mehr losrennen und vorwärtsstolpern, indem sie in neue Medien vorbehaltlos investieren. Zudem haben zahlreiche missglückte Social-Media-Kampagnen gezeigt, dass der Einstieg ohne Strategie und ohne Management-Ansatz auch im Social Web mit hohen Risiken verbunden ist. Hinzu kommt, dass in der derzeitigen Wirtschaftskrise Budgets zweimal durchdacht werden, bevor sie für derartige Maßnahmen zur Verfügung stehen. Das zeigt sich auch am Bedarf von ROI-Berechnungen und KPIs in Social Media.
Zahlreiche Unternehmen engagieren sich derzeit auf Facebook im Rahmen ihres Social Media Marketings. Facebook hat es nach jahrelangen Bemühungen geschafft, Konzerne auf seine Seite zu locken. Doch auch dieser Einsatz ließ lange auf sich warten. Große Konzerne benötigen vor solchen Einsätzen einen enormen Anlauf. Neue Abteilungen müssen gegründet, Kompetenzen mit hohen Kosten aufgebaut werden. Google Plus hat also noch einen weiten Weg vor sich, während Facebook diesen Schritt bereits hinter sich hat.
„Aus sich herauswachsen“
Schaut man sich Google Plus unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten an, erscheint es derzeit wie ein Netzwerk von vielen. Selbst die Eingabe „Google Plus“ unter der Google-Suche listete anfangs das Social Network noch an zweiter Stelle auf. Die Frage, die sich hier stellt, ist, warum Google Plus eigentlich auch Google heißt. Vielleicht, weil es wie alle anderen Angebote ein Teil des Google-Universums bleiben soll, nebst Google Suche, Bilder, Maps, Streetview, Books, Docs, Calendar, Blogs, News und vielen mehr. Das würde auch bedeuten, dass es eine Beilage ist und nur im Schlepptau von Google überlebt. Das Social Network wäre in diesem Fall kein Selbstläufer. Das Wachstum und der Erfolg wären auf diese Weise an die Nutzung der Google-Umgebung gebunden und Google Plus wäre nicht sein eigener Garant. Es wäre ein Portal, das noch nicht gelernt hat, selbstständig zu schwimmen und den Big Brother Google braucht, um über Wasser zu bleiben. Wie lange jedoch kann Google das Produkt künstlich pushen und wie wird es sich eines Tages von den Fesseln von Google befreien können?
Alle Hinweise deuten darauf hin, dass Google Plus kein eigenständiges Leben führen wird. Das zeigt Googles vergangene Strategie. Bislang haben fast alle Produkte von Google-Accounts profitiert. Facebook dagegen hat den Markt auf natürliche Weise erobert – selbstständig und ohne die Hilfe eines großen Labels dahinter. Denn Facebook ist sein eigenes Label. Und für sein Wachstum hat Facebook sogar nicht mal in Werbung investieren müssen.
Weiße Westen und dunkle Seiten
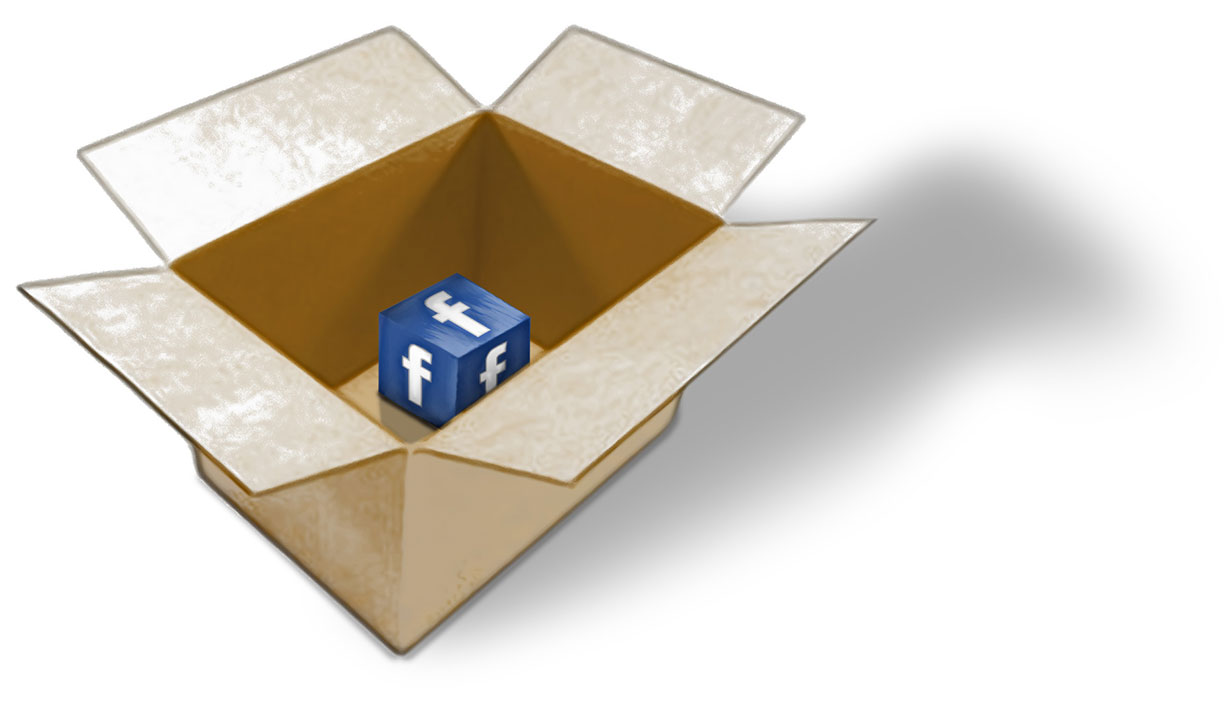
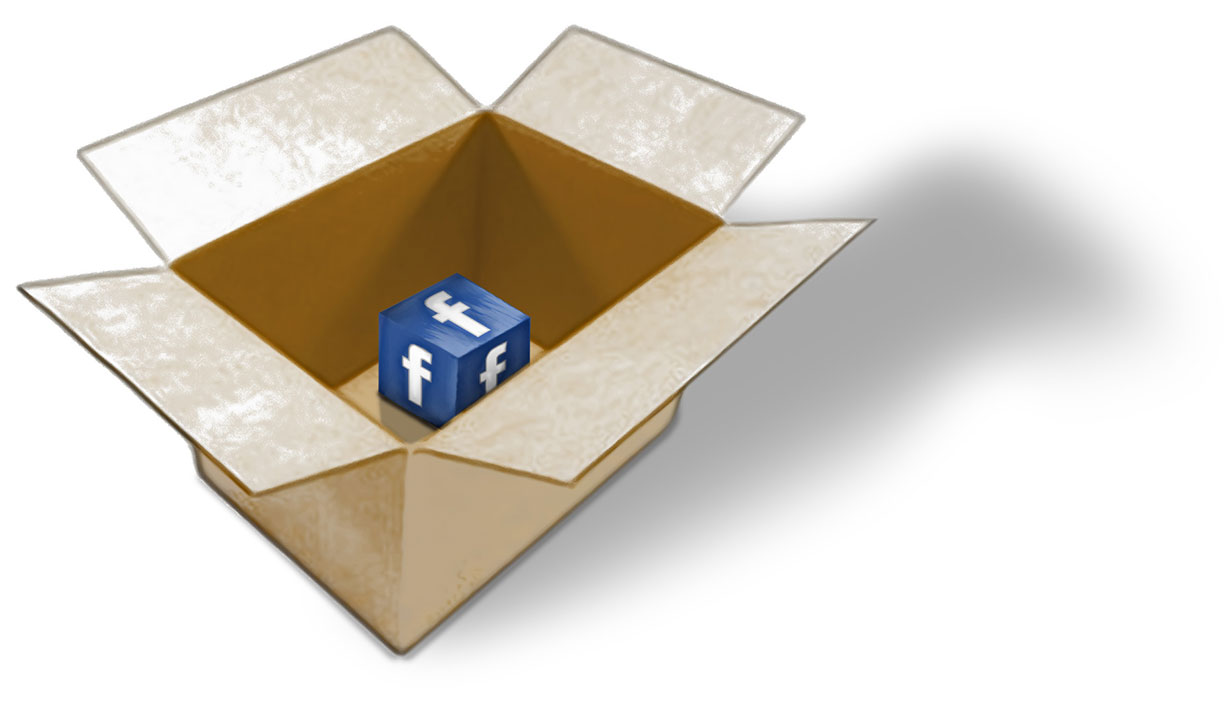
Ein weiteres Risiko, das Google mit sich trägt, ist seine derzeitige Reputation. Die Geschichte zeigt, dass ein negatives Image ein langes Leben führt. Konsumenten vergessen oft die vergangenen Ereignisse dahinter, das Image dagegen bleibt in den Köpfen der Menschen haften.
Ein Beispiel ist Microsoft. Es ist nicht lange her, da hatte der Software-Riese seine „dunkle Seite“ zum Vorschein gebracht, als er rigoros gegen den Wettbewerber Netscape vorging. Diese Entwicklung ging in die Geschichte als „Browser Wars“ ein. In den Folgejahren der Browserkriege zwischen 1995 und 1998 gingen daher mehrere Klagen bei Microsoft ein. Schließlich reichten sogar das US-Justizministerium und 19 amerikanische Bundesstaaten die berühmte „Antitrust-Klage“ gegen den Software-Giganten ein. Dennoch schaffte es Microsoft aufgrund seines Verdrängungswettkampfs, Netscape fast vollkommen auszumanövrieren.
Obwohl Microsoft den Krieg erfolgreich gewonnen hatte, nahm der Marktanteil des Internet Explorers in den nachfolgenden Jahren fast um die Hälfte ab. Viele Kritiker behaupten, dass der Nachgeschmack, den Microsoft beim harten Wettbewerbskampf hinterließ, die Nutzer auf Open Source Software wie Firefox und Linux hat umsteigen lassen. Dieses Image des „bösen Riesen“ wird Microsoft auch heute nach über 10 Jahren nicht los.
Wenn Unternehmen zu Riesen heranwachsen, verschwindet ihr Heiligenschein. Apple hat seine weiße Weste lange aufrechterhalten können. Mit Steve Jobs war das Unternehmen das Pendant zu Unternehmen wie Microsoft. Mit einem solchen Sympathieträger hatten Medien es schwer, Apple zu schmähen. Mit dem Rückgang des Idols bleibt Apple nun aber auch schutzlos. Angriffsfläche gegen Apple gibt es derzeit genug. Proprietäre Systeme, restriktive DRM-Modelle, der Kampf gegen Adobe und zuletzt die Klage gegen Samsung zeigen längst, dass auch Apple ein Wirtschaftsgigant ist, der nie einen harten Verdrängungswettbewerb gescheut hat.
Die Imagegrippe hat Google vor Kurzem erst erwischt. Seit der Einführung von Street View steht nun auch Google ständig unter Verdacht, sich über jegliche Datenschutzrichtlinien hinwegzusetzen. Selbst Google Analytics befindet sich seitdem auf der Abschlussliste der Datenschützer, obwohl die Speicherung von IP-Adressen für die Darstellung von Webstatistiken seit der Entstehung des Webs zum Standard gehört. Das will jedoch keiner hören – auch nicht die Tatsache, dass Produkte wie Street View lange vor Google existiert haben, wie beispielsweise mit dem Angebot Sightwalk. Wer möchte jedoch Anbieter wie Sightwalk, ein kleines Kölner Unternehmen, schon an den Pranger stellen? Große Medien haben nur große Konzerne als Sündenböcke in ihrem journalistischen Repertoire. Das zieht am besten und genau das wollen die Menschen hören. Da bleibt die Frage offen, wie Google Plus das Vertrauen der Nutzer unter diesen Umständen gewinnen möchte. Erste Stimmen, dass Google Plus letztlich auch wieder gegen Datenschutzrichtlinien verstößt, sind bereits jetzt zu hören.
Idole lassen sich nicht zerstören. Selbst die Vorwürfe gegen Michael Jackson wegen mehrerer Kindesmissbrauchsfälle ließen seine Fans nicht einmal mit der Wimper zucken. Die Gesellschaft braucht ihre Helden. Wer sich an ihnen vergreift, wird abgestraft mit Protest und Empörung. Die Medien müssen mit ihren Vorwürfen still halten, wenn es um die Helden geht. Was tatsächlich hinter den Stars steckt, wird von den Konsumenten sogar besser ignoriert als von den Medien. Die Gesellschaft braucht ihre Ideal-Figuren. Ein solcher Publikumsliebling ist auch Mark Zuckerberg, der in Pulli und Adidas-Badelatschen in die Kameras lächelt. Sein Erscheinungsbild schreit geradezu danach, das Bild der Traumfigur dem Publikum zu verkaufen. Die unzähligen PR-Berater, die sich um ihn tummeln, müssen es lieben zuzusehen, wie der von ihnen aufgebaute Zuckerberg das Herz der Medien erobert. Auch Steve Jobs hatte seine PR-Berater. Und diese haben auch ihn bühnenreif gestaltet – Jeans und schwarzer Pulli. Kein Gürtel. Schuldlos musste er stets aussehen.
Zuckerberg muss sich derzeit noch nicht vor negativem Image fürchten. Jungunternehmer sind beliebt. Sie zeigen der Bevölkerung, dass jeder es schaffen kann – auch die Jungen. In ihnen steckt das, wovon viele schon als Kinder geträumt haben: den „Großen“ die Stirn bieten und zeigen, dass Klugheit nicht im Alter, sondern im Kopf steckt. Dabei ist es nebensächlich, wenn Unternehmer wie Shawn Fanning gegen Urheberrechte verstoßen und ganze Industrien zerstören. Viele erfreuen sich daran zuzusehen, wie sich Wirtschaftsmächte, geleitet von Anzügen und akkurat gescheiteltem Haar, vor pubertären Pickeln in Jeans und Schlappen fürchten müssen. Akzeptiert ist ein Vorgehen, wenn es rebellisch ist. Revolution geht einher mit Zerstörung. Sogar der Vorwurf, Mark Zuckerberg hätte die Idee für Facebook von den Zwillingsbrüdern Winklevoss geklaut, hat sein Image nicht ankratzen können. Auch Zuckerberg kauft man „Böses“ nicht ab. Google, „der Vernichter der Privatsphäre“, wird es hingegen sehr schwer haben, gegen sein Image anzugehen. Google hat längst kein Idol mehr. Den Namen Larry Page hört man nur noch selten in Verbindung mit Google, geschweige denn mit Google Plus.
Die Macht der Gewohnheit
Einen Trend zu kippen, ist mit hohen Marketing-Kosten verbunden. Eingeübte Verhaltensweisen der Menschen werden zur Routine. Neue Technologien werden daher nicht von heute auf morgen von Konsumenten angenommen. Die Vergangenheit zeigt, dass sich nicht die Systeme und Technologien auf dem Markt etabliert haben, die offenbar besser waren. Die innovativsten und fortschrittlichsten Modelle müssen nicht zwangsläufig auf Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen.
So hat sich die von Sony eingeführte MiniDisc im Jahre 1991 auf dem Markt nicht durchsetzen können, obwohl sie deutlich robuster war als eine herkömmliche CD. Die MiniDisc sollte eine Revolution werden, wie einst die CD. Zudem bot sie damals bereits die Möglichkeit, digital und sofort aufzunehmen, während das Brennen von CDs zur damaligen Zeit wesentlich aufwändiger und teurer war. Auch die Telekom war ihrer Zeit voraus und hatte 1997 das erste Bildtelefon T-View 100 eingeführt und stellte schmerzhaft fest, dass anscheinend kein Haushalt Interesse daran hatte. Und während heute alle Voraussetzungen erfüllt sind, auf den klassischen Fernseher zu verzichten, kaufen Konsumenten weiterhin große Fernsehgeräte, schauen Kabelfernsehen, kaufen teure Komponenten wie Festplattenrekorder und Blu-ray-Player, statt auf einen HTPC umzurüsten. Inhaltliche Merkmale wie Programmauswahl, Download-Angebot und Vielfalt stehen meistens gar nicht erst zur Debatte. Stattdessen diskutiert der Ottonormalverbraucher lieber über die Unterschiede zwischen LCD und Plasma oder Größe und Aussehen seines TV-Gerätes.
Google Plus hat einige interessante Features, die innovativ sind. Die Circles und die angebotene AJAX-Technologie, die Drag-and-drop ermöglicht, sind wahrscheinlich Indizien für ein erweitertes, durchdachteres und besseres Social-Network-Konzept. Doch „besser“ war in der Marktwirtschaft selten ein Argument für den Erfolg eines Systems. Der Gewohnheit des Menschen ist nur schwer entgegenzuwirken.
Die Einführung von neuen Systemen kostet vor allem eines: Geld. Zwar hat Google genug davon, doch selbst dann ist mit Geld nicht alles zu machen. Ein erfolgreiches Management verlangt eine Strategie, die kompetent ist. Google Plus hat sich ein gewagtes Ziel vorgenommen: das Abwerben und Umerziehen von Facebook-Nutzern.
Kauf und Verkauf
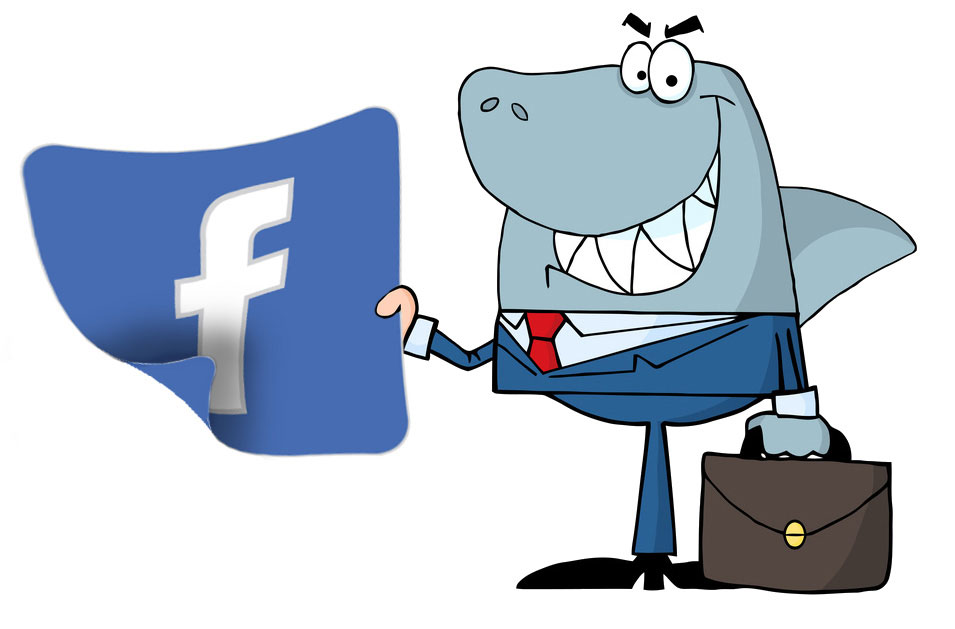
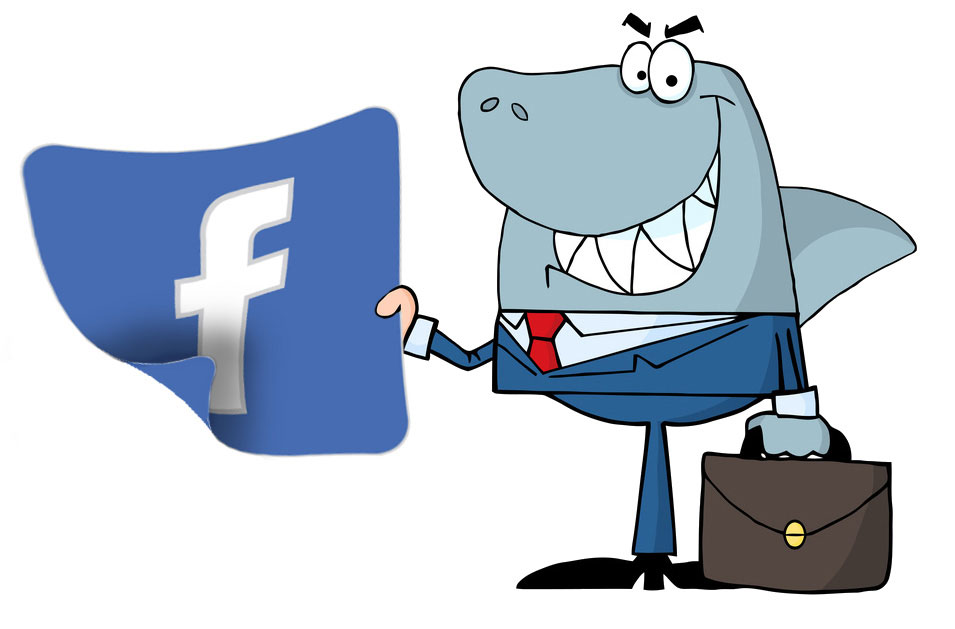
Die Grundsätze eines Second Movers sind unter anderem die, dass man die Fehler des Marktführers nicht wiederholen möchte. Man kann von den schlechten Erfahrungen des First Movers lernen. Viele unnötige Investments und zeitaufwändige Schritte lassen sich dadurch vermeiden – Google Plus muss es also viel besser machen, um erfolgreich zu sein. Das bezieht sich jedoch nicht nur auf die Funktionalität der Plattform. Die Marktdominanz, die strategische Ausrichtung, das Marketing und das Management müssen um ein Vielfaches besser sein als bei Facebook. Und da liegt das eigentliche Problem. Was ist eigentlich die Strategie von Facebook? Was kann Google Plus von einer nuancierten Zukunft eines Social Networks lernen?
Die Zukunft von Facebook ist nach wie vor ungewiss. Diese Unsicherheit scheint die Investoren derzeit aber nicht zu stören. Diese sind Risikokapitalisten wie Digital Sky Technologies – ein russischer Investor mit engen Verbindungen zu amerikanischen Banken wie Goldman Sachs. Derartige Geldgeber haben ihre Exit-Strategien in der Schublade. Das heißt, dass bereits beim Invest ein Plan existiert, das erkaufte Unternehmen gewinnbringend an den nächsten abzustoßen. Solche Pläne dürften auch für Facebook in den nächsten Jahren zum Einsatz kommen, sobald sich Anzeichen für einen Rückgang zeigen. Die Käufer sind oft die Second Mover am Markt, die sich dadurch den ersten Platz erkaufen – oder Unternehmen, die durch den Kauf einen weiteren Sektor auf dem Markt erschließen wollen. Diversifikation ist der Schlüsselbegriff: Man kauft sich in eine andere Branche ein, um zu wachsen. Es ist ein Machtspiel. Und das wissen auch Investoren wie Digital Sky Technologies, die nur darauf warten, dass sich ein solcher Käufer meldet. Dann ist der Investor raus aus dem Spiel und Facebook gehört einem anderen. Ob Facebook mit derartigen Zielen der Investoren überhaupt langfristig zu einem Weltkonzern aufwachsen möchte, ist daher äußerst fraglich.
Hinzu kommt die Schnelllebigkeit des Webs. Sie erscheint wie ein gewaltiges Monstrum, das alles, was sich ihm in den Weg stellt, niederreißt und weiterzieht. Das derzeit stärkste Gegenargument ist zudem die Marktsättigung. In einem dynamischen Markt reicht es nicht aus, lediglich die Nachfrage zu befriedigen, wusste bereits auch der Vater des Managements Peter Drucker. Die Nachfrage muss nicht nur geschaffen, sondern auch durch Marketing am Leben gehalten werden. Sättigung heißt im Grunde nichts anderes als: Das Produkt wird irgendwann langweilig.
So innovativ Facebook derzeit zu sein scheint, hat es keine Antidote gegen die bevorstehende Sättigungsphase. Vielleicht wird es auch Facebook ergehen wie einst Myspace, das letztlich für 35 Millionen Dollar über den Tisch ging. Bislang haben alle Indizien dagegen gesprochen, dass es Facebook mal schlecht ergehen könnte – bis Google Plus auf den Markt kam. Denn eines ist soweit klar: Das Scheitern von Google Plus sollte für Google kein allzu großes Problem darstellen. Es ist nicht das Hauptprodukt und nicht mal ein gewinnbringendes dazu. Die einzige Wirkung, die man derzeit erkennt, ist die, dass der Marktanteil von Facebook womöglich abnehmen wird. Und für Google kann es eigentlich nichts Besseres geben, als dass Facebook Marktanteile verliert. Dann wäre Facebook ein gefundenes Fressen für interessierte Käufer.
Für die Investoren ist das ein Pokern um den besten Bieter. Ohnehin wird Facebook derzeit mit 50 Milliarden Dollar von Vielen für deutlich überbewertet gehalten. Derartige „Internet-Blasen“ sind von Investoren beabsichtigt. Die beiden Investoren Goldmann Sachs und der russische Internet-Investor tun zurzeit alles, um den Zugang der Öffentlichkeit zu ihren Finanzdaten geheim zu halten. Derzeit weiß im Grunde niemand, was Facebook erwirtschaftet und wie viel es tatsächlich wert ist. Die von Facebook sporadisch veröffentlichten Zahlen müssen nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde ist zurzeit machtlos gegen diese Vorgehensweise, solange das Unternehmen nach amerikanischem Gesetz seine Zahl unter 500 Investoren hält. Das dürfte auch der Grund sein, weswegen sich Facebook gegen einen Börsengang sperrt: Hier wäre der wirkliche Wert sichtbar und Finanzdaten müssten offengelegt werden. Für die Investoren wäre eine derartige Offenlegung kontraproduktiv.
Es ist Gang und Gäbe, dass Internetportale von Investoren hochgepokert werden und der geschätzte Wert hier möglichst hoch gehalten wird. Diese Überbewertung wirkt sich beim Verkauf positiv auf die Investoren aus, da der Verhandlungsspielraum breiter ist. Gleichzeitig bedeutet das, dass es Investoren entgegenkommt, wenn Internetportale an Wert verlieren und das Interesse anderer Marktspieler wecken. Der Wert nach dem Verlust ist immer noch gut genug, wenn er vorher ohnehin deutlich überbewertet war. Ein gewisser Werteverlust ist also oft sogar willkommen. Das an der Theke zum Verkauf angebotene Unternehmen wäre in einer Art „Sommerschlussverkauf“. Insofern ist der Eintritt von Google Plus auf dem Markt vielleicht nicht einmal ein Dorn im Auge der Facebook-Investoren.
Ohnehin wäre Google ein sehr interessanter Käufer. Dann hätte Google auch das große Geschäft für Social Networks in seinen Händen. In einem solchen Spiel sind letztlich nur die Mitglieder des Portals die Verlierer. Im schlimmsten Fall muss man sich eben seine „Freunde“ anderswo suchen.










